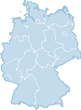Bauchspiegelung (Laparoskopie)
Die Bauchspiegelung (Laparoskopie) ist ein Verfahren, das es ermöglicht die inneren Organe zu begutachten und eventuell weitere chirurgische Maßnahmen durchzuführen, ohne dass eine große Bauchoperation nötig ist. Man kann die Laparoskopie in die diagnostische Bauchspiegelung und die operative Laparoskopie einteilen. Praktisch allerdings sind diese beiden Verfahren kaum voneinander zu trennen. Häufig wird eine Laparoskopie durchgeführt, um eine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, aber die operative Behandlung im Rahmen der Laparoskopie wird direkt angeschlossen. Das heißt die Laparoskopie ist erst diagnostisch, dann aber operativ. In der Gynäkologie (Frauenheilkunde) wurde die Bauchspiegelung als erstes durchgeführt. In diesem Bereich ist die Laparoskopie zum Beispiel eine Möglichkeit, um die Ursache einer unerwünschten Kinderlosigkeit zu klären.
Wann wird eine Bauchspiegelung durchgeführt?
Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Arzt seiner Patientin eine Bauchspiegelung vorschlagen könnte. Die Diagnostische Laparoskopie macht es möglich alle Organe mit Vergrößerung darzustellen und zu untersuchen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass eine Patientin unter Unterbauchbeschwerden leidet, deren Ursache in anderen Untersuchungsverfahren wie dem Ultraschall nicht entdeckt werden konnte. Es ist verständlich, dass es in einem solchen Fall geraten sein kann, die weiblichen inneren Organe direkt zu untersuchen. So können beispielsweise Auffälligkeiten an der Gebärmutter, den Eierstöcken, aber auch dem Peritoneum, also dem Bauchfell, erkannt werden.
Ein Krankheitsbild, bei dessen Verdacht die Laparoskopie ein besonders geeignetes und häufig angewandtes diagnostisches Verfahren ist, ist die sogenannte Endometriose. Dies ist eine gutartige, chronische Krankheit, bei der sich Gebärmutterschleimhaut-Flecken im Bauchraum verteilt vorfinden lassen. Die Patientinnen haben dabei oft starke Schmerzen.
Auch Entzündungen, die Ursache einer Unerwünschten Kinderlosigkeit, oder eine Eileiterschwangerschaft können mit der diagnostischen Laparoskopie unter Umständen ausgemacht werden. Dabei ist es auch möglich Abstriche zu machen, oder Gewebsproben für eine nähere Untersuchung zu entnehmen. Häufig ist es möglich die Erkrankung operativ gleich im Rahmen der Laparoskopie zu behandeln, das heißt an die diagnostische Laparoskopie schließt sich nahtlos die operative Laparoskopie an.
Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane können häufig operativ therapiert werden. Das gilt nicht nur für benigne, also gutartige Erkrankungen, auch bei bösartigen Befunden kann die operative Laparoskopie häufig zur Behandlung eingesetzt werden.
Wie funktioniert eine Bauchspiegelung?
Das wichtigste medizinische Instrument der Laparoskopie ist das Laparoskop, der Bauchspiegel. Dabei handelt es sich um einen circa einen Zentimeter dicken Stab mit einer Länge von etwa dreißig Zentimetern, der im Bauchraum frei zu bewegen ist. Dieses Instrument besteht genauer aus einem Linsensystem, das über ein Kabel mit einer Kaltlichtquelle verbunden ist. Dieses System macht es möglich über eine außen gelegene Kamera Bilder der inneren Organe auf einen, oder auch mehrere Monitore zu senden. So kann der Verlauf der Operation bequem beobachtet werden. Dabei sind die Bilder auf dem Bildschirm bis zu vierfach vergrößert. Es ist auch möglich während der Operation Videoaufnahmen, oder Bilder zu machen. Das Laparoskop und alle anderen für die Operation benötigten Instrumentarien werden über Trokare (hülsenartige Luftschleusen) in den Bauchraum eingeführt.
Worauf muss der Patient vor dem Eingriff achten?
Am Abend vor dem Eingriff sollte ab 22:00 Uhr nichts mehr gegessen und getrunken werden. Auch Kaugummis und Zigaretten sollten gemieden werden.
Wichtig ist, dass die Patientinnen den Operateur, oder den Anästhesisten (Narkosearzt) vor dem Eingriff darüber informieren, ob sie regelmäßig Medikamente benötigen. Dies ist daher von Bedeutung, da manche Medikamente schon mehrere Tage vor dem Eingriff nicht mehr eingenommen werden dürfen. Für die behandelnden Ärzte ist es ebenfalls wichtig, dass sie über eventuell bestehende Erkrankungen des Herzens und der Lunge informiert zu werden. Diese können eine Kontraindikation für den Eingriff darstellen. Selbes gilt unter anderem auch für Entzündungen im Bauchraum und Blutungsneigungen bei Gerinnungsstörungen des Blutes.
Außerdem ist es ratsam am Operationstag weite Kleidung zu tragen, da der Bauch nach dem Eingriff zunächst etwas aufgebläht ist.
Der Untersuchungsablauf
Die Bauchspiegelung ist ein Eingriff, bei dem die Patientinnen im vornherein eine Vollnarkose verabreicht bekommen. Das bedeutet, dass sie währenddessen nicht bei Bewusstsein sind und eine Schmerzempfindung ebenfalls durch spezielle Medikamente verhindert wird. Auch die Muskulatur wird lahmgelegt. Da dies aber auch die Atemmuskulatur betrifft, müssen die Patientinnen bei der Operation beatmet werden. Zu Anfang der Bauchspiegelung wird mithilfe von im Durchschnitt circa drei bis sieben Litern Kohlenstoffdioxid der Bauch etwas aufgebläht, um im Bauchraum mehr Platz zu gewinnen und den Operierenden eine bessere Sicht zu verschaffen. Wie viel Gas genau eingeleitet wird, ist je nach körperlicher Konstitution von Patient zu Patient unterschiedlich. Um zu vermeiden, dass der Bauch zu sehr "aufgeblasen" wird, wird regelmäßig der Druck darin gemessen.
Für die Einleitung des Gases gibt es ein spezielles Werkzeug, die sogenannte Veress-Nadel. Diese wird unter dem Nabel in den Bauch eingestochen. In diesem Bereich besteht keine große Gefahr größere Gefäße zu verletzen, zudem ist die Haut an dieser Stelle nicht so dick. An die Nadel wird ein Schlauch angeschlossen, über den dann durch eine bestimmte Pumpe , den Insufflator, das Gas eingebracht werden kann, bis sich eine kleine Kuppel über den Bauchorganen gebildet hat.
Nachdem nun der Bauch ausreichend mit dem über die Nadel eingeflossene Kohlenstoffdioxid gefüllt wurde, kann das Laparoskop über einen Trokar eingeführt werden. Dies passiert an derselben Stelle, die für die Veress-Nadel als Punktionsstelle benutzt wurde. Der Trokar hat mit etwa 10 Millimetern einen größeren Durchmesser als die Veress-Nadel. Am Ende läuft er spitz zu, was das Durchstechen der Bauchdecke vereinfacht. Letztendlich wird aber nur eine Art Hülse, über die das Laparoskop eingeführt werden kann, an dieser Stelle belassen. Dadurch, dass die Trokare so konstruiert sind, dass sie gasdicht sind, kann über sie kein Gas entweichen. Mit dem Laparoskop kann man die Organe im Bauchraum sehr gut beurteilen. Dies wird dadurch erleichtern, dass dieses Instrument sehr beweglich ist.
Nachdem es nun in den Bauch eingebracht wurde, wird zur Sicherheit noch einmal geschaut, ob es irgendwo zu einer Blutung gekommen ist. Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall. Werden weitere „Werkzeuge" für den Eingriff benötigt, können diese dann ebenfalls über Trokare in den Bauchraum eingeführt werden. Auch hier werden besondere Instrumentarien benutzt, die sich von denen unterscheiden, die bei offenen Operationen verwendet werden. Als Region für die Zugänge dient hier der Schamhaarbereich.
Nun kann der Operateur die inneren Bauchorgane genau untersuchen und beispielsweise kleine Gewebsproben entnehmen, um diese im Labor näher beurteilen zu lassen. Sollen der Uterus (Gebärmutter), Eileiter und Eierstöcke dargestellt werden, wird der Operationstisch etwas schief gestellt, um einen möglichst freien Blick in das kleine Becken gewährleisten zu können. Dies ist leicht nachzuvollziehen, denn wenn die Patientin mit dem Kopf etwas tiefer liegt, rutscht der Darm etwas nach oben und verdeckt nun nicht mehr die Sicht auf die Organe des Beckens.
Hat der Operateur seine Arbeit im Bauchraum beendet, werden die Werkzeuge wieder herausgezogen und das Gas abgelassen. Die Schnitte, die für das Einbringen der Werkzeuge nötig waren, werden sauber mit feinen Nähten verschlossen und mit Verbandsmaterial versorgt.
Mögliche Komplikationen bei der Laparoskopie
Wird die Bauchspiegelung von erfahrenen Operateuren durchgeführt, handelt es sich um einen recht risikoarmen Eingriff. Wie bei jeder Operation können jedoch Komplikationen wie Blutungen, Verletzung von Organen, sowie Infektionen nicht ganz ausgeschlossen werden. Selten kann es auch einmal nötig sein, dass eine weitere Operation erfolgt.
Letzte Aktualisierung am 20.04.2021.